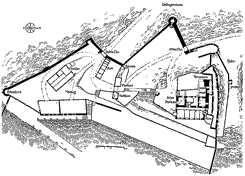Geschichte:
Bei der auf einem Steilhang über dem Neckarufer gelegenen Burg Hirschhorn handelt es sich um die namengebende Stammburg der Herren von Hirschhorn, die im Spätmittelalter zu einer der führenden nichtlandesherrlichen Adelsfamilien des Neckarraumes aufstiegen. Nach der offensichtlich Mitte des 13. Jh. angelegten Burg benannte sich ab 1270 Johannes von Hirschhorn, der vermutlich aus der Ehe eines Herren von (Neckar-)Steinach und einer Dame aus dem Hause Hirschhorn hervorging. Wann die Herren von Hirschhorn ins Neckartal gelangten, lässt sich nach bisherigem Kenntnisstand nicht sagen. Sie begleiteten das Erbtruchsessenamt am kurpfälzischen Hof zu Heidelberg und verfügten über umfangreichen Streubesitz am unteren Neckar, erwarben zeitweise den Pfandbesitz der Städte Mosbach, Sinsheim und Weißenburg (Elsaß) sowie die Burg Reinhausen mit dem damaligen Dorf Mannheim. Im 14. Jh. vollzog sich auch die Entwicklung des unterhalb der Burg Hirschhorn gelegenen Ortes zur Stadt, die 1404 mit einem Karmeliterkloster ausgestattet wurde. Die Burg Hirschhorn, die bis 1632 im Besitz der Familie verblieb, wurde 1317 dem Erzbischof von Mainz als Offenhaus zur Verfügung gestellt. Nach dem Erlöschen der Familie im Mannesstamm 1632 wurden Burg und Stadt als heimgefallenes Lehen vom Erzstift Mainz eingezogen. Zu Beginn des 19. Jhs. wurde Hirschhorn dem Großherzogtum Hessen-Darmstadt zugeschlagen. (Thomas Steinmetz; Jens Friedhoff)
Bauentwicklung:
Die architektonische Gestalt der ursprünglichen Burg ist aufgrund der späteren Umbauten nur in groben Umrissen zu rekonstruieren. Sie bildete ein ungefähres Rechteck mit Seitenlängen von ca. 20 x 25 m. Erhalten sind hiervon noch die Schildmauer an der Bergseite sowie Reste des frühgotischen Wohnbaues an der Neckarseite. Ob die Burg tatsächlich in ihrer ersten Bauphase einen Bergfried besaß, ist ungeklärt. Der heutige schlanke Turm wird erst ins 14. Jahrhundert gehören.
Die Entstehungszeit der beiden Vorburgen und umfangreichen Zwingeranlagen ist bisher ungeklärt. Die Ringmauer der Vorburgen mit mehreren Türmen ist bereits für Feuerwaffen konzipiert und gehört in die erste Hälfte des 15. Jahrhunderts. Die Gebäude der Vorburg und die hufeisenförmige Bastion sind in ihrer zeitlichen Stellung ebenfalls unklar, werden aber teilweise erst dem 16. Jahrhundert entstammen.
Aufgrund der Enge der Kernburg wurde ab 1586 an deren Flussseite bzw. an den gotischen Wohnbau ein hoch aufragendes Renaissancegebäude angebaut. Initiatoren der Baumaßnahmen waren Ludwig von Hirschhorn und seine Gattin Maria von Hatzfeldt, die nach dem Ableben ihres Gatten den Renaissancebau (sog. Hatzfeldtbau) vollendete. Nach Verlusten im 19. Jahrhundert, vor allem durch den Einsturz des gotischen Wohnbaues, wurde die Burg ab 1959 zum Schlosshotel ausgebaut. Hierbei wurde an den Hatzfelder Bau als eigener Baukörper eine gemauerte Terrasse angebaut, später der ruinöse Marstall in der unteren Vorburg zwecks Nutzung als Bettenhaus wieder überdacht. (Thomas Steinmetz)
Baubeschreibung:
Die Burg hat ihre in Jahrhunderten gewachsene Gestalt weitgehend erhalten können. Ihre Silhouette wird dominiert durch den hoch aufragenden Hatzfeldt-Bau, der ab 1596 an den nur als Ruine erhaltenen gotischen Wohnbau angebaut wurde. In den 1980er Jahren wurde die Farbgebung des Gebäudes nach Originalbefunden erneuert. Die Reste des unter dem Schleppdach des Hatzfelder Baues befindlichen Wohnbaues enthalten auch jene der Burgkapelle mit mittelalterlicher Ausmalung. Aus der Gründungszeit der Burg ist außerdem noch die Schildmauer mit dem jüngeren bergfriedähnlichen Turm erhalten. Weitaus größere Grundfläche als die Kernburg nehmen die beiden Vorburgen ein, die ungewöhnlicherweise durch gleich zwei Tore zugänglich sind. Vor dem oberen Tor der Halsgraben (heute Parkplatz) und dahinter ursprünglich vier Mauerringe. (Thomas Steinmetz)
Arch-Untersuchung/Funde:
Ab 1929 wurden Reste des ursprünglichen Zugangs zur Kernburg freigelegt und sichtbar belassen.